Wenn es um eine intelligente, zukunftweisende und dabei stabile
Energieversorgung geht, spielt Vehicle-to-Grid (V2G) eine wesentliche Rolle.
Denn diese Technologie nutzt die Batterien von Elektroautos sowohl als mobile
Kraftwerke als auch als Speicher. Klingt einfach – die Umsetzung ist aber
alles andere als trivial. Das fängt beim Fahrzeug und der richtigen
Ladestation an, verlangt die entsprechenden
Kommunikationsstandards zwischen allen Beteiligten und hört
bei den
gesetzlichen Rahmenbedingungen
auf.
Das Potenzial von Vehicle-To-Grid
Die Energiekrise der letzten Jahre hat deutlich gezeigt: Eine Energieversorgung auf Basis fossiler Brennstoffe ist nicht nur teuer, sondern macht auch geopolitisch angreifbar. Genau deshalb forciert Deutschland weiterhin den massiven Ausbau erneuerbarer Energien – bis 2030 sollen laut Bundesregierung 80 Prozent des Strombedarfs aus Sonne, Wind & Co. gedeckt werden. Die zentrale Herausforderung bleibt dabei die Volatilität der Erzeugung.
Ein entscheidender Hebel für die Lösung dieses Problems ist ein intelligentes Stromnetz – das so genannte „Smart Grid“. Darin wird überschüssige Energie zwischengespeichert und bei Bedarf wieder ins Netz eingespeist. Flexible Speicher sind dafür unverzichtbar – und die gute Nachricht ist: Millionen davon stehen bereits bereit – in Form von Elektroautos.
Doch bislang bleibt das enorme Potenzial dieser mobilen Speicher noch oft ungenutzt – etwa dann, wenn Fahrzeuge parken, aber nicht mit dem Stromnetz kommunizieren. Das ändert sich langsam. Neue Fahrzeugmodelle mit bidirektionaler Ladefähigkeit kommen vermehrt auf den Markt. Die entsprechenden technischen Standards wie ISO 15118-20 sind gesetzt, und erste Pilotprojekte von Netzbetreibern und Autoherstellern laufen – etwa im Rahmen von Vehicle-to-Grid (V2G) und Vehicle-to-Home (V2H).
Zahlreiche aktuelle Studien, unter anderem vom Fraunhofer ISE (2023) und der Agora Energiewende, zeigen: Das Zusammenspiel aus E-Mobilität und Energiewende wird Realität. In der Agora-Studie „Klimaneutrales Stromsystem 2035“ heißt es: „Wenn bis 2035 rund 25 Prozent der Elektro-Pkw am Vehicle-to-Grid-System teilnehmen und davon im Durchschnitt 40 Prozent aktiv verfügbar sind, ergibt sich ein Flexibilitätspotenzial von bis zu 28 Gigawatt.“ Zusätzlich hat das Fraunhofer ISE einen Leitfaden zum bidirektionalen Laden veröffentlicht, in dem hervorgehoben wird, dass in Deutschland bereits Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von etwa 50 Gigawattstunden in Elektrofahrzeugen vorhanden sind. Dies entspricht fast dem Fünffachen der in Deutschland installierten stationären Batteriespeicher.
Quellen: Agora Energiewende, Fraunhofer-Institute ISE und ISE im Auftrag der Organisation Transport & Environment (T&E) in einer Studie
Realisierte V2G-Projekte
Unser erstes Produkt haben wir 2024 in Frankreich gelauncht: Der neue Renault R5 lädt bidirektional. Dabei kommt das Elektroauto kommt von Renault, die Ladestation von Mobilize und der Strom von uns. Ein Meilenstein in der V2G-Geschichte ist geschafft. Gesteuert wird der Energiefluss über unsere intelligente Plattform, die auf Netzbedarf, Ladezustand und Nutzerverhalten reagiert.
Das Ergebnis:
- Reduktion von Netzengpässen
- Optimierte Nutzung von Sonnen- und Windstrom
- Konkrete finanzielle Vorteile für Flottenbetreiber und E-Auto-Besitzer
- Fazit: Das Projekt zeigt, dass Vehicle-to-Grid funktioniert – technisch, wirtschaftlich und klimafreundlich.
Dass Vehicle-to-Grid funktioniert, hatten wir bereits im Jahr 2018 in Hagen bewiesen, als erstmals ein Nissan Leaf in einer V2G-Anwendung nach den Richtlinien der Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E, Amprion) wie ein Großkraftwerk präqualifiziert und das Elektroauto für die Primärregelleistung (PRL) zugelassen wurde. Auch der Besitzer profitierte: Der Nissan Leaf „verdiente“ damals gut 20 Euro pro Woche, indem er mit lediglich maximal acht Kilowatt Leistung am PRL-Markt teilnahm.
Die Umsetzung von V2G
Was fehlt noch für den Durchbruch? Die Technologie für Vehicle-to-Grid (V2G) ist bereit – jetzt ist die Politik am Zug. Denn ohne eindeutige gesetzliche Rahmenbedingungen bleibt die Nutzung bidirektional ladender Elektrofahrzeuge weitgehend Theorie.
Gesetzliche Hürden: Noch viele offene Fragen
Obwohl das Thema auf der politischen Agenda steht, war V2G in zentralen Regelwerken wie dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und dem Energie-Umlagen-Gesetz (EnUG) bislang nicht eindeutig geregelt. Unklar war etwa:
- Zählt ein E-Auto als Stromverbraucher oder Stromerzeuger?
- Welche Abgaben fallen bei der Rückeinspeisung an?
- Gibt es Vergütungsmodelle für V2G-Strom?
Diese Unsicherheiten bremsten nicht nur private Nutzer:innen, sondern auch Energieversorger und Netzbetreiber aus.
Was ist neu ab 2026?
Die deutsche Bundesregierung hat endlich die regulatorischen Rahmen geklärt und damit wird V2G ab 2026 wirtschaftlich rentabel werden. Wie das? Der Bundestag hat am 13.11.2025 über eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes entschieden. Damit gehören nun doppelte Netzentgelte der Vergangenheit an. Strom, der aus dem öffentlichen Netz entnommen, zwischengespeichert und später wieder ins Netz eingespeist wird, beispielsweise durch bidirektionale Elektroautos oder stationäre Batterien, ist ab Januar 2026 von Netzentgelten und Stromsteuer befreit.
Technikfrage geklärt: Wallbox oder Auto?
Lange war unklar, ob die V2G-Technik besser im Fahrzeug oder in der Wallbox untergebracht ist. Inzwischen ist die Richtung klar: Dank des neuen Standards ISO 15118-20 wird die notwendige Intelligenz direkt im Auto verbaut. Die Wallbox bleibt einfach – sie muss lediglich kompatibel sein. Das reduziert langfristig die Kosten für Verbraucher:innen und Installateur:innen.
AC oder DC beim bidirektionalen Laden: Wo stehen wir 2025?
Die Frage, ob bidirektionales Laden per AC oder DC umgesetzt werden sollte, ist mittlerweile weniger ideologisch und mehr praktisch-technisch geprägt. Während früher DC-Wallboxen als Favorit galten, hat sich das Bild inzwischen verschoben – auch dank technischer Standards und politischer Entwicklungen.
Was hat sich geändert?
- ISO 15118-20 ist seit 2024 im breiten Rollout und unterstützt AC- und DC-basiertes bidirektionales Laden.
- Immer mehr E-Fahrzeuge ab Werk unterstützen AC-V2G – inklusive intelligenter Kommunikation mit dem Netz.
- Einige Hersteller (z. B. Renault, Hyundai) setzen nun gezielt auf AC-V2G mit Fahrzeugintelligenz, auch weil sich die EU um vereinheitlichte Netzrichtlinien bemüht, was das Hauptargument für DC-Wallboxen entkräftet.
Vehicle-to-Grid über AC vs. DC – der aktuelle Vergleich:
|
Kriterium |
AC-V2G (im Auto) |
DC-V2G (in der Wallbox) |
|---|---|---|
|
Kosten Fahrzeug |
höher (Komplexität im Fahrzeug) |
geringer |
|
Kosten Wallbox |
günstiger |
teurer |
|
Flexibilität |
hoch – bei EU-weiter Normierung |
gut – Wallbox regelt Netzanforderungen lokal |
|
Technikstatus |
zunehmend serienreif dank ISO 15118-20 |
ausgereift, aber teuer und weniger verbreitet |
|
Verbreitung |
im Aufschwung (viele Pilotprojekte mit AC-V2G) |
häufig in kommerziellen Szenarien |
Stecker & Protokolle: Kein Problem mehr
Seit April 2022 ist der CCS-Standard (Combined Charging System) auch für bidirektionales Laden freigegeben. Das entsprechende Kommunikationsprotokoll (ISO 15118-20) ist heute in vielen Neufahrzeugen integriert oder kann via Over The Air-Update nachgerüstet werden.
Fazit: AC holt auf – und könnte der neue Standard werden
Was früher als Nachteil für AC-V2G galt (z. B. Fahrzeugkomplexität und regionale Netzauflagen), verliert mit Standardisierung und EU-Regulierung an Bedeutung. DC bleibt für Spezialanwendungen interessant, aber im privaten Bereich und für Flotten zeichnet sich AC-V2G als die flexiblere und kosteneffizientere Lösung ab.
V2G-fähige Ladestationen
|
Hersteller & Modell |
Standard |
Status: bestellbar? |
Mobilize Verso |
AC, Typ 2 |
bestellbar |
OpenWB Pro |
AC, Typ 2 |
bestellbar |
Wallbox Quasar 1 |
DC, CHAdeMO |
bestellbar |
Smartfox Pro Charger 2 |
AC, Typ 2 |
bestellbar |
ambibox |
DC, CCS |
bestellbar |
debel r16 |
AC, CCS / CHAdeMO |
bestellbar |
E3/DC Edison |
DC, CCS Typ 2 |
bestellbar |
Eaton Green Motion DC 22 |
DC, CCS/ CHAdeMO |
bestellbar |
EnerCharge DCW20/DCW40 |
DC, CCS Typ 2 |
bestellbar |
EVTEC sospeso & charge |
DC, CCS Typ 2 / CHAdeMO |
bestellbar |
Indra Vehicle-to-Home Charger |
DC, CHAdeMO |
bestellbar |
Quelle: McKinsey EV Charging Infrastructure Service Line
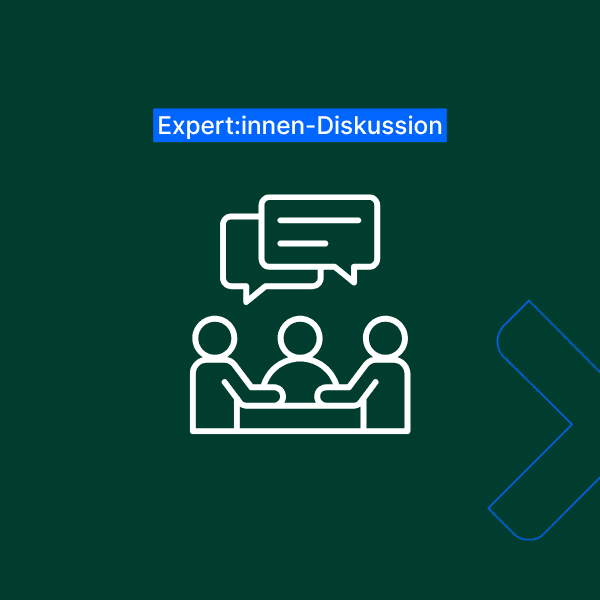
Expert:innendiskussion
Was hat es mit bidirektionalen Ladestandards auf sich? Wofür stehen ISO-15118 und OCPP? Darüber und mehr sprechen unsere 3 Expert:innen.
_5441c8a80b7c88123367b60c3d46bf78.png&w=154&q=75)
