ElaadNL-Studie High Potential for Home Bidirectional Charging to Support the Grid (NL, 2025)
Die ElaadNL-Studie „High Potential for Home Bidirectional Charging to Support the Grid“ zeigt, dass bidirektionale Heimladestationen bis 2050 ein flexibles Leistungspotenzial von bis zu 4,5 Gigawatt (GW) für das Stromnetz bereitstellen könnten. Diese Form von Vehicle-to-Grid, bei der Elektrofahrzeuge zu Hause nicht nur laden, sondern auch Strom zurück ins Netz einspeisen, kann helfen, die Netzbelastung zu reduzieren. Nutzer:innen laden ihr Fahrzeug hauptsächlich nachts oder zu günstigen Zeiten und speisen während der Spitzenlasten Energie zurück ins Netz, was zu einer Entlastung der Stromnetze beiträgt. Durchschnittlich können Haushalte laut Studie 1–2 kW während Spitzenzeiten einspeisen, einige sogar bis zu 11 kW pro Fahrzeug.
Die hohe Flexibilität unterstützt die Integration erneuerbarer Energien und hilft, Engpässe im Netz zu vermeiden. Pilotprojekte wie in Utrecht bestätigten die technische Machbarkeit und den Nutzen von V2G im städtischen Kontext. Die Studie betont, dass trotz des hohen Potenzials wichtige Schritte zur Standardisierung und Regulierung notwendig sind, bevor eine großflächige Umsetzung möglich ist.
ElaadNL empfiehlt zur Förderung von V2G u.a. folgende politische Maßnahmen:
- Schaffung klarer regulatorischer Rahmenbedingungen zur Integration von V2G, insbesondere bezüglich standardisierter technischer Verbindungen und Kommunikationsprotokolle zwischen Fahrzeugen, Ladestationen und Netzbetreibern.
- Einrichtung finanzieller Anreize und Förderprogramme für die Installation bidirektionaler Ladeinfrastruktur, um die Markteinführung und Verbreitung zu beschleunigen.
- Anpassung der Netztarife und Energiemarktmodelle, sodass V2G-Nutzer für bereitgestellte Netzflexibilität und Energieeinspeisung angemessen vergütet werden.
Quelle: https://elaad.nl/en/high-potential-for-home-bidirectional-charging-to-support-the-grid/
Eurelectric und EY: Plugging Into Potential (UK, 2025)
Die Studie „Plugging into Potential“, veröffentlicht von Eurelectric und EY, analysiert das Potenzial von Elektrofahrzeugen (EVs) als flexible Energiespeicher im europäischen Stromsystem. Sie zeigt auf, wie EVs durch Vehicle-to-Grid (V2G)-Technologien zur Netzstabilität beitragen und die Integration erneuerbarer Energien fördern können.
Zentrale Ergebnisse der Studie sind:
- 114 TWh Flexibilitätspotenzial bis 2030: Die Batterien von EVs könnten bis zu 114 Terawattstunden (TWh) Energie speichern und bei Bedarf ins Netz zurück speisen. Das entspräche ca. 4 % des jährlichen Strombedarfs Europas oder der Versorgung von 30 Millionen Haushalten.
- Über 10 % Deckung des Strombedarfs bis 2040: Mit fortschreitender V2G-Integration könnten E-Autos bis 2040 mehr als 10 % des europäischen Strombedarfs decken.
- Smart Charging reduziert Netzbelastung: Intelligentes Laden kann Spitzenlasten um bis zu 6 % senken - so wären teure Netzausbauten nicht mehr notwendig.
- Einsparungen für Netzbetreiber: Durch die Nutzung von Flexibilitätsoptionen wie V2G könnten Verteilnetzbetreiber jährlich bis zu 4 Milliarden Euro einsparen.
Quellen: industrialnews.co.uk, https://evision.eurelectric.org/report-2025/ (Englisch)
FfE: V2G Integration in Europa (2025)
Das Whitepaper „Die Integration von V2G in Europa“ der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) analysiert die Umsetzung von Vehicle-to-Grid (V2G) in Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Es zeigt auf, dass die Integration bidirektional ladefähiger Elektrofahrzeuge in das Energiesystem in jedem Land unterschiedlich voranschreitet:
- Deutschland: Die V2G-Implementierung beschränkt sich bisher auf Pilotprojekte. Es fehlt eine übergeordnete Strategie zur Nutzung kleinteiliger Flexibilität im Energiesystem, und regulatorische Rahmenbedingungen sind weniger förderlich im Vergleich zu den anderen beiden Ländern.
- Großbritannien: Hier existieren bereits kommerzielle V2G-Angebote. Das Land fördert aktiv die marktliche Integration von kleinteiliger Flexibilität, einschließlich V2G, und bietet regulatorische Spielräume für Pilotprojekte.
- Frankreich: Obwohl ebenfalls kommerzielle V2G-Angebote vorhanden sind, wird die Umsetzung hauptsächlich von Automobilherstellern vorangetrieben. Derzeit plant Frankreich keine marktlichen Anreize für Vehicle-to-Grid, da Netzbetreiber auf alternative steuerbare Erzeuger oder Verbraucher zurückgreifen.
Die Studie betont, dass die Vermarktung von V2G am Spotmarkt in allen 3 Ländern bereits einen Mehrwert bietet, sofern die Stromnetze nicht zusätzlich belastet werden. Für eine wirtschaftliche und skalierbare Umsetzung von V2G wird die Förderung standardisierter technischer Anbindungen über Ländergrenzen hinweg empfohlen. Sowohl Regulierungsbehörden als auch Anbieter technischer Lösungen sollten entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, um die Integration von V2G zu erleichtern.

P3 Bidirectional Charging – Worth the Hype? (2025)
Die Studie von P3 liefert folgende Ergebnisse bzgl. Wert und Anwendungsfällen von V2G.
1. Finanzieller Wert für den Verbraucher
In günstigen Fällen könnte ein Verbraucher durch bidirektionales Laden 300 bis 400 Dollar pro Jahr sparen. Die realen Einsparungen hängen stark ab von:
- Stromtarifstrukturen (insbesondere Nutzungszeit- oder Bedarfsgebühren).
- Anreizen und Teilnahme an Netzprogrammen.
- Ausrüstungskosten und Degradationseffekten bei der EV-Batterie.
2. Wert fürs Stromnetz
Die Technologie hat das Potenzial, wertvolle Netzdienstleistungen zu erbringen, wie zum Beispiel:
- Frequenzregulierung
- Spitzenlastabdeckung
- Reservestrom bei Stromausfällen
Versorgungsunternehmen sind an V2G interessiert, um das Netz zu stabilisieren und den Ausbau der Infrastruktur zu verringern.
Allerdings stellen sich auch technische und regulatorische Herausforderungen: Es fehlen standardisierte Kommunikationsprotokolle und Zusammenschaltungsregeln. Zudem sind die Fahrzeughersteller noch zurückhaltend - sie haben noch Bedenken hinsichtlich der Batteriegarantie.
Laut der Studie könnten sinnvolle V2G Anwendungsfälle sein:
- Hauseigentümer mit Solaranlagen profitieren mehr von V2H zur Optimierung des Eigenverbrauchs.
- Flottenanwendungen (z. B. Schulbusse oder Lieferfahrzeuge) sind aufgrund vorhersehbarer Fahrpläne und größerer Betriebsgrößen vielversprechend.
Quelle: https://www.p3-group.com/p3-updates/bidirectional-charging-worth-the-hype/ (Englisch)
Fraunhofer-Institute ISI und ISE (2024)
Die Studie „Batteries on Wheels: The Untapped Potential of EVs“, durchgeführt von den Fraunhofer-Instituten ISI und ISE im Auftrag von Transport & Environment (T&E), analysiert das wirtschaftliche Potenzial der Vehicle-to-Grid-Technologie in Europa. Laut den Ergebnissen kann bidirektionales Laden erhebliche Einsparungen und Vorteile für das europäische Energiesystem bringen.
Die wichtigsten Ergebnisse der Studie sind:
- Einsparungen im Energiesystem: Durch die flächendeckende Einführung von V2G könnten die jährlichen Energiesystemkosten in der EU bis 2040 um 8,6 % gesenkt werden, was Einsparungen von etwa 22,2 Mrd. € pro Jahr entspricht.
- Reduzierter Bedarf an stationären Speichern: Die Notwendigkeit für stationäre Batteriespeicher könnte um bis zu 92 % reduziert werden, da Elektrofahrzeuge als dezentrale Speicher fungieren.
- Integration erneuerbarer Energien: V2G macht eine bessere Integration von Solarenergie möglich. Das könnte die PV-Leistung um bis zu 40 % erhöhen.
- Beitrag zur Stromversorgung: Bis 2040 könnten Elektrofahrzeuge bis zu 9 % des jährlichen Strombedarfs der EU decken und während Spitzenlastzeiten 15–20 % des momentanen Strombedarfs liefern.
- Vorteile für Verbraucher: Besitzer:innen von Elektroautos könnten durch bidirektionales Laden bis zu 52 % ihrer jährlichen Stromkosten einsparen, abhängig von Faktoren wie Standort, Besitz einer Solaranlage und Batteriekapazität.
- Längere Batterielebensdauer: Entgegen verbreiteter Befürchtungen kann bidirektionales Laden die Lebensdauer von EV-Batterien um bis zu 9 % verlängern, da sie in einem optimalen Ladezustand gehalten werden.
Quellen: Transport & Environment, electrive.net
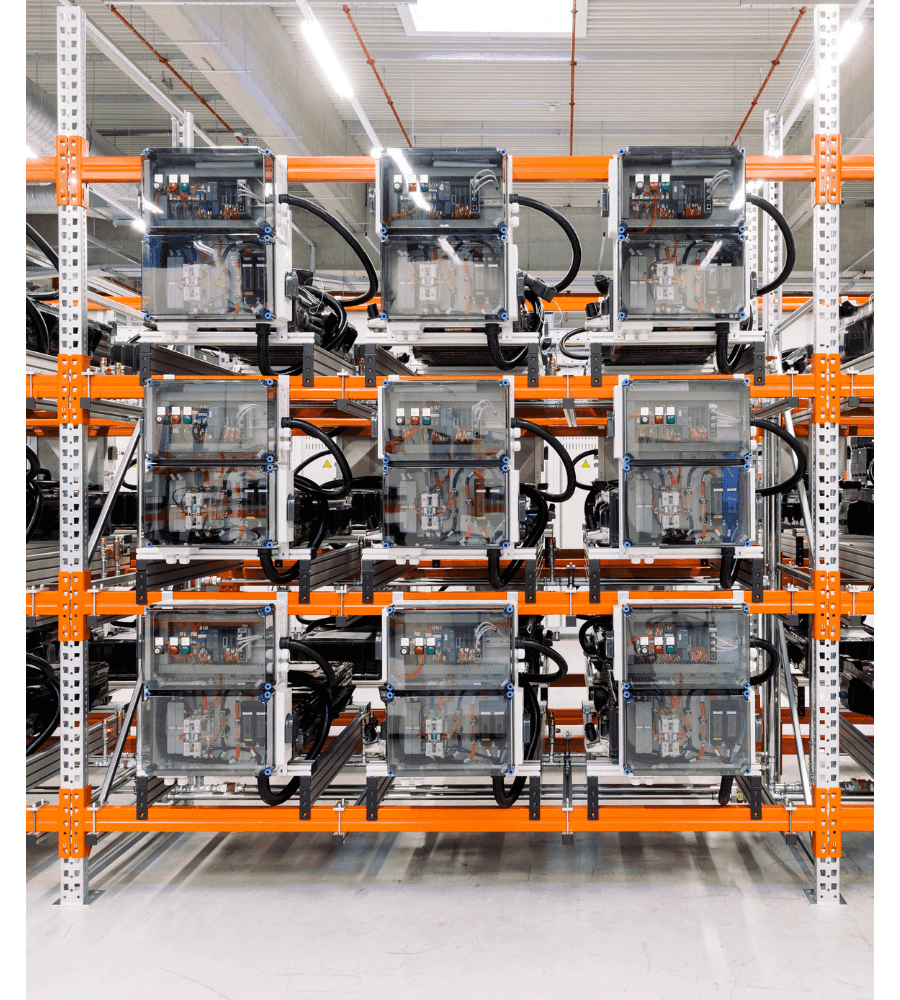
Whitepaper lesen
Studie der RWTH Aachen: Optimierung der Lebensdauer von E-Auto-Batterien
Unser gemeinsam mit der RWTH Aachen veröffentlichtes Whitepaper zeigt, wie intelligentes und bidirektionales Laden die Lebensdauer von Batterien beeinflusst.
Joint Research Centre der Europäischen Kommission (2021)
Die Studie „Vehicle-to-Grid and/or Vehicle-to-Home Round-Trip Efficiency“ des Joint Research Centre (JRC) der Europäischen Kommission untersucht die Effizienz von bidirektionalem Laden, genauer: das Be- und Entladen von Elektrofahrzeugen (EVs) im Kontext von Vehicle-to-Grid (V2G) und Vehicle-to-Home (V2H). In Laborexperimenten wurde festgestellt, dass die Round-Trip-Effizienz – also der Wirkungsgrad des gesamten Lade- und Entladezyklus – bei etwa 80 % liegt. Diese Effizienzrate bedeutet, dass rund 20 % der Energie während des Lade- und Entladeprozesses verloren gehen. Solche Verluste sind entscheidend für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit von V2G- und V2H-Systemen. Die JRC-Studie betont außerdem, dass technische Verbesserungen bei Ladegeräten und Batteriemanagementsysteme notwendig sind, um diese Verluste zu minimieren und die Attraktivität bidirektionaler Ladelösungen zu steigern.
Quelle: JRC Publications Repository (PDF, Englisch)
EV Energy Taskforce: Energising Our Electric Vehicle Transition (UK, 2019)
Die Studie „EV Energy Taskforce: Energising Our Electric Vehicle Transition“ (Phase 1) aus dem Vereinigten Königreich liefert zentrale Empfehlungen für die erfolgreiche Integration von Elektrofahrzeugen (EVs) in das Energiesystem. Im Fokus stehen dabei Interoperabilität, intelligente Ladeinfrastruktur und die Ausrichtung auf Verbraucherbedürfnisse.
Kernaussagen der Studie sind:
- Standardisierung und Interoperabilität: Es besteht dringender Handlungsbedarf bei der Entwicklung von Standards und Verhaltensregeln, um die Interoperabilität und den Datenaustausch zwischen dem EV-Sektor und dem Stromsystem zu ermöglichen.
- Koordinierte Planung: Effektive lokale und nationale Planung sowie Koordination sind erforderlich, um effiziente Investitionen zu ermöglichen und ein Gleichgewicht zwischen Zukunftssicherheit und dem Risiko von Fehlinvestitionen zu schaffen.
- Intelligentes Laden: Smart Charging ist entscheidend, unterstützt durch ein belastbares Netzwerk und klare Marktsignale, um die Kosten für die Versorgung von Millionen von EVs zu senken.
Diese 3 Prioritäten durchziehen die 21 Vorschläge der EV Energy Taskforce, die in der Phase-1-Bericht veröffentlicht wurden. Ein zentrales Prinzip dabei ist, dass der Übergang zu EVs am besten gelingt, wenn stets das bestmögliche Ergebnis für Verbraucher:innen – also EV-Fahrer:innen – angestrebt wird.
Quelle: https://evenergytaskforce.com/reports/phase-one-report/ (Englisch)
_5441c8a80b7c88123367b60c3d46bf78.png&w=154&q=75)
